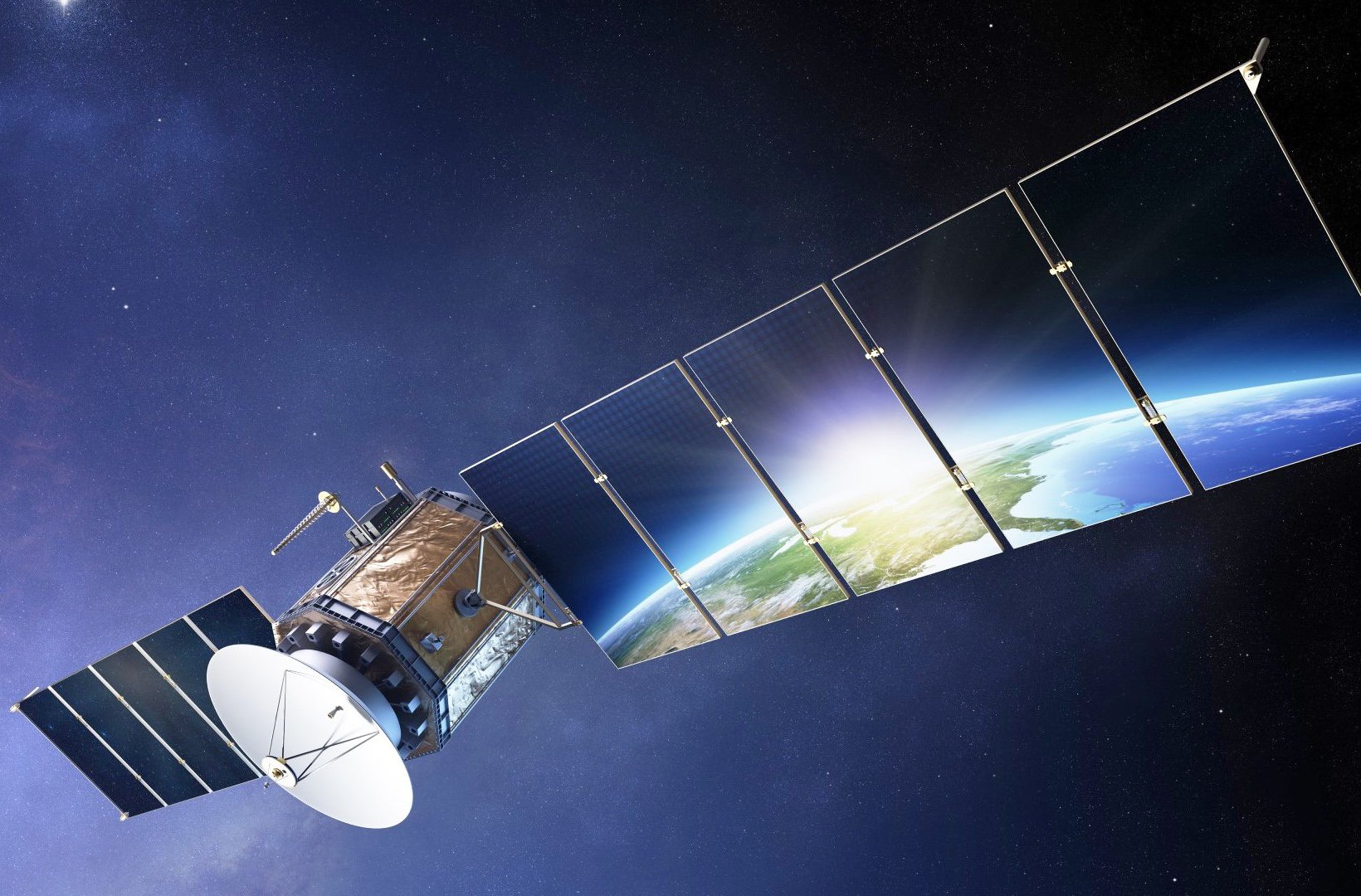
Aus der Ferne – Satelliten revolutionieren die Überwachung der Biodiversität
Immer häufiger stützt sich die Überwachung der biologischen Vielfalt auf Daten, die von Satelliten stammen. Wie lassen sich Satellitenbilder am besten nutzen? Und welche Erkenntnisse liefern sie?
Den ersten Satelliten, Sputnik 1, schickte 1957 die Sowjetunion ins All. Dieses Objekt aus Aluminium, nicht größer als ein Wasserball, sendete während seiner 92 Tage im All Funksignale aus. Es brauchte noch weitere 10 bis 15 Jahre weltraumgestützter Aufrüstung im Kalten Krieg, bis die Satelliten so weit waren, dass eine visuelle Beobachtung unseres Planeten damit möglich war. Lange Zeit war die Aussagekraft der Bilder jedoch recht begrenzt.
Als Sputnik 1 seinen Jungfernflug antrat, war der Begriff der „Biodiversität“ noch nicht geprägt, geschweige denn geläufig. Erst Mitte der 1980er Jahre gewann er in der Forschung an Bedeutung, und erst in jüngster Zeit hat er in der Öffentlichkeit eine breitere Resonanz gefunden.
Heute werden Satelliten und biologische Vielfalt immer häufiger in einem Atemzug genannt. Die aus dem Weltraum geschossenen Bilder von der Erdoberfläche und die Daten, die sich daraus gewinnen lassen, sind inzwischen mehr oder weniger untrennbar mit Biodiversität verbunden.
Heather Reese ist Dozentin für Fernerkundung und GIS an der Universität Göteborg. In ihrer Forschung – mit Schwerpunkt Biodiversität – nutzt sie Satellitendaten. Seit sie in den 1990er-Jahren mit ihrer Forschung auf diesem Gebiet begann, haben sich Qualität und Häufigkeit der Bilder verbessert.
„Mit dem Sentinel-2-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation ist zum Beispiel alle fünf Tage ein Bild auf Höhe des Äquators erhältlich und noch viel häufiger in der Nähe der Pole. Das ist eine positive Entwicklung.“
Ein wichtiges Instrument
Für Reese sind Satellitenbilder eine Möglichkeit von vielen, um die auf dem Gebiet der Biodiversität erforderlichen Daten zu sammeln. Satellitenbilder bieten einen Überblick und sind in der Lage, größere Landschaftsbereiche zu erfassen. Auf ihnen lassen sich weitreichende Veränderungen erkennen.
„In der Frage der biologischen Vielfalt ist es zum Beispiel möglich, eine Menge Daten über Veränderungen der Vegetation zur Auswertung zu erhalten. Nimmt sie gerade deutlich zu? Wie grün ist sie? Wird die Vegetation produktiver? In arktischen und alpinen Gebieten, die ich untersuche, lässt sich eine „Verbuschung“ beobachten, das heißt mit dem wärmeren Klima wachsen Büsche üppiger. Wir sehen auch den gegenteiligen Effekt, die so genannte „Verbräunung“, wo Pflanzen aufgrund von Trockenheit oder Frostschäden in ihrer Produktivität nachlassen oder sogar absterben. Eine mögliche Ursache ist die früher einsetzende Schneeschmelze und dass weniger Schutz wie auch weniger Wasser vorhanden ist.“
Satellitenbilder bieten zudem die Möglichkeit, eine Entwicklung über die Zeit zu verfolgen. Satelliten können über einen langen Zeitraum verlässliche globale Daten sammeln, die es ermöglichen, die wichtigsten Ereignisse in einem Gebiet zu verfolgen.
„Mit Satellitenbildern können wir bis in die 1970er- und 1980er-Jahre zurückgehen und nachvollziehen, wie sich die Vegetation entwickelt hat.“
Automatisch bereitgestellte Daten
In ihrer eigenen Forschung nutzt Reese Satellitenbilder in Kombination mit Feldstudien und Drohnenüberwachung. Für sie sind Satelliten ein Instrument von vielen: „Wie Satellitenbilder am besten genutzt werden, hängt stark davon ab, was beobachtet werden soll. Bei manchen Forschungsprojekten nutze ich nur Satellitenbilder und gehe ins Feld, weil ich der Meinung bin, dass Feldarbeit immer sein muss. Ich hatte auch schon Projekte, bei denen ich nur Drohnen eingesetzt habe. In diesen Fällen muss tatsächlich jemand hinausgehen und die Drohne steuern, während Satelliten automatisch aktualisierte Bilder liefern.“
Heather Reese veranschaulicht den Unterschied zwischen Satelliten- und Drohnenüberwachung anhand eines Projekts, das die Universität Göteborg derzeit zusammen mit der Universität Lund zum Thema Bestäuber durchführt. Drohnen mit Multispektralkameras und LiDAR werden eingesetzt, um die Lebensräume von Bestäubern zu kartieren, zum Beispiel wie hoch die Vegetation wächst und wie viel Schatten sie potenziell bietet. Satelliten werden häufiger für die Analyse größerer Gebiete eingesetzt, um die biologische Vielfalt anhand der Landschaftsmerkmale zu analysieren.
„Beim Bestäuberprojekt nutzen wir Drohnen, um zu bestimmten Zeitpunkten im Sommer sehr detaillierte Aufnahmen zu machen. Die Satelliten sind hingegen ununterbrochen in Betrieb und sammeln Daten in hoher Frequenz. So können wir zum Beispiel die Phänologie der Pflanzen in der Zeit verfolgen, in der wir keine Drohnen einsetzen. Über Satelliten erhalten wir die Zeit- und Landschaftsperspektive und können diese mit Drohnendaten kombinieren, damit der Detailgrad entsteht, den wir für die Bestäuberanalyse benötigen.
Energie und Ressourcen richtig eingesetzt
Dag Wästlund, Leiter der Abteilung Data Science and AI bei Vattenfall, hat Satellitenbilder und deren Daten in ähnlicher Weise genutzt – um sich einen Überblick zu verschaffen, nicht zuletzt beim Thema Biodiversität im Bereich der Wasserkraft. „Früher war unsere Maßnahmenplanung standortspezifisch. Wir mussten rausgehen und vor Ort eine Bestandsaufnahme machen. Dabei fehlte uns dann der Überblick. Mit Satellitenbildern können wir die richtigen Stellen aus Sicht der Renaturierung identifizieren oder beispielsweise viel einfacher Ufervegetation anlegen. Wir sehen das Gesamtbild und können gezielt die Stellen auswählen, die am stärksten betroffen sind, so dass Energie und Ressourcen dorthin fließen, wo sich am meisten bewirken lässt.“
Satellitenbilder haben sich auch bei der Überwachung der Biodiversität im Zusammenhang mit der Stromverteilung als nützlich erwiesen.
„Satellitenbilder haben es viel einfacher gemacht, die verschiedenen Lebensraumtypen zu identifizieren, die beispielsweise in Korridoren von Freileitungsleitungen zu finden sind. So erhalten wir einen Überblick über alle Korridore in Schweden und ihre Entwicklung im Laufe der Jahre. Auf diese Weise können wir besser überprüfen, ob unsere Maßnahmen tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielen. Wir können unsere Arbeit leichter mit Zahlen belegen und besser nachverfolgen.“
In Zukunft eine noch bessere Auflösung
Durch die Möglichkeit, Bilder großer Gebiete im Zeitverlauf zu erhalten, können Forschende beispielsweise die Wassertiefe und den Zustand von Uferbereichen überwachen und erkennen, wo geplante Maßnahmen ansetzen sollten.
„Es wird eine Art mehrstufige Rakete sein, wobei die Satellitenbilder den ersten Teil bilden“, sagt Wästlund. „Auf Grundlage dieser Daten können wir uns Fragen stellen wie: Was sollten wir tun und wo schauen wir zuerst hin? Gestützt auf die Satellitenbilder wird dann in einem nächsten Schritt entschieden, wo in der zweiten Stufe beispielsweise der Einsatz von Drohnen sinnvoll ist, um noch mehr Bilder in höherer Auflösung zu erhalten, was näher analysiert und wo vielleicht eine Ortsbesichtigung durchgeführt werden sollte.“
Wenn sich die Entwicklung der Satellitenbildgebung im gleichen Tempo wie in den letzten zehn Jahren fortsetzt, brauchen wir vielleicht bald gar keine Nahaufnahmen von Drohnen mehr, blickt Wästlund in die Zukunft. Die Häufigkeit, mit der Bilder aufgenommen werden können, die Art der verwendbaren Sensoren und die Qualität der Bilder werden sich weiter und rasant verbessern.
„Vor zehn Jahren hatten Satellitenbilder eine Auflösung von eineinhalb bis drei Metern pro Pixel. Ein Pixel entsprach so vielen Metern in der Realität, dass man sehr große Gebäude oder Flugplätze sehen konnte. Einfach gesagt: große Dinge. Heute liegt die Auflösung bei zehn bis dreißig Zentimetern pro Pixel, das ist ein extremer Unterschied. Deshalb sind Satellitenbilder so wichtig geworden. Sie bieten einen Überblick – aber auch Details.“

Registrieren Sie sich für unseren Newsletter THE EDIT
THE EDIT ist der neue monatliche Newsletter von Vattenfall. Jede Ausgabe beleuchtet ein neues brennendes Thema aus der Welt der nachhaltigen Energie und der fossilen Freiheit.



